Warum so viele psychisch Kranke irgendwann noch weitere Diagnosen bekommen
Viele psychische Erkrankungen teilen genetische Ursachen. Eine große Analyse erklärt, warum Betroffene im Laufe ihres Lebens oft mehrere Diagnosen erhalten.

Viele Betroffene bekommen mehr als eine psychische Diagnose – neue genetische Erkenntnisse erklären, warum sich Symptome verändern, die Ursachen aber oft ähnlich bleiben. © Pexels
Eine Depression kommt selten allein. Wer einmal eine psychische Diagnose erhält, erlebt oft, dass Jahre später eine weitere hinzukommt. Auf depressive Phasen folgen Angststörungen. Nach scheinbar stabilen Zeiten treten neue Symptome auf. Für Betroffene wirkt das verwirrend und frustrierend. Viele zweifeln an früheren Therapien oder suchen die Ursache bei sich selbst.
Eine groß angelegte genetische Analyse der Virginia Commonwealth University auf Basis von Daten von mehr als sechs Millionen Menschen ordnet dieses Muster nun erstmals belastbar ein. Sie zeigt, dass mehrere psychische Erkrankungen häufig auf gemeinsamen biologischen Grundlagen beruhen – und ihre Ursachen sehr eng miteinander verknüpft sind.
Mehrfachdiagnosen sind kein Zufall
Mehrfachdiagnosen entstehen häufig nicht zufällig. Sie sind auch kein Hinweis auf fehlerhafte Diagnostik. Entscheidend ist ein anderer Zusammenhang: Viele psychische Erkrankungen beruhen auf denselben genetischen Risikofaktoren. Einzelne Diagnosen bauen oft auf einer gemeinsamen biologischen Grundlage auf.
Besonders eng überschneiden sich Depressionen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS). Sie teilen den Großteil ihres genetischen Risikos. Auch Schizophrenie und bipolare Störung sind genetisch deutlich näher verwandt, als lange angenommen. Deshalb verschwimmen die Grenzen zwischen Diagnosen im Alltag – und Therapien lindern häufig nur Teile eines biologisch zusammenhängenden Krankheitsbildes.
Wenn mehrere psychische Erkrankungen dieselben Ursachen teilen
Die Auswertung stammt aus dem internationalen Psychiatric Genomics Consortium und wurde Ende 2025 im Fachjournal Nature veröffentlicht. Analysiert wurden 14 psychiatrische Erkrankungen, darunter Depressionen, Angststörungen, ADHS, Autismus und Suchterkrankungen. Ein zentrales Ergebnis: Die genetischen Risiken dieser Erkrankungen überlappen sich stark.
In der klinischen Praxis hat das spürbare Folgen. Diagnosen beruhen bis heute auf Symptomen, nicht auf Laborwerten. Verändern sich die Beschwerden, ändert sich oft auch die Diagnose. Die genetische Grundlage bleibt jedoch ähnlich. Das erklärt, warum viele Menschen im Laufe ihres Lebens mehrere psychiatrische Diagnosen erhalten, obwohl sich das zugrunde liegende biologische Risiko kaum verändert.
Fünf genetische Muster prägen die seelische Gesundheit
Die Analyse ordnet die 14 Erkrankungen fünf übergeordneten genetischen Gruppen zu. Diese Gruppen erklären im Durchschnitt rund zwei Drittel der genetischen Anfälligkeit einzelner Diagnosen. Es geht also nicht um alleinige „Krankheitsgene“, sondern um breite Risikomuster, die verschiedene Störungen miteinander verbinden.
Besonders stark fällt eine Gruppe auf: sogenannte internalisierende Erkrankungen. Dazu zählen Depressionen, Angststörungen und PTBS. Bei diesen Störungen überschneiden sich etwa 90 Prozent der genetischen Risikofaktoren. Disorder-spezifische Gene spielen hier nur eine geringe Rolle. Ähnlich eng verbunden sind Schizophrenie und bipolare Störung, die lange als klar getrennte Krankheitsbilder galten.
Die wichtigsten Zahlen aus der Studie
- 1.056.201 Betroffene mit mindestens einer psychiatrischen Diagnose wurden ausgewertet
- 14 psychische Erkrankungen flossen in die Analyse ein
- Fünf genetische Risikogruppen erklären im Schnitt rund 66 Prozent der genetischen Anfälligkeit
Diese Zahlen zeigen die Dimension des Befunds. Mehrfachdiagnosen sind kein Randphänomen, sondern die statistische Normalität.
Warum das Risiko früh im Leben entsteht
Ein weiterer wichtiger Punkt: Viele der beteiligten Gene wirken sehr früh. Sie beeinflussen die Entwicklung des Gehirns bereits vor der Geburt und in den ersten Lebensjahren. Besonders betroffen sind bestimmte Zelltypen im Gehirn. Bei Depressionen und Angststörungen spielen Oligodendrozyten eine Rolle. Diese Zellen sorgen dafür, dass Nervensignale schnell und zuverlässig weitergeleitet werden. Bei Schizophrenie und bipolarer Störung stehen Gene im Vordergrund, die in erregenden Nervenzellen aktiv sind.
Das genetische Risiko ist damit von Anfang an vorhanden. Umweltfaktoren wie Stress, Traumata oder soziale Belastungen entscheiden häufig, ob und wann sich eine Erkrankung zeigt. Sie sind Auslöser – nicht die alleinige Ursache.
Warum Therapien oft an Grenzen stoßen
Viele Medikamente werden bereits heute über Diagnosegrenzen hinweg eingesetzt. Antidepressiva helfen bei Angststörungen. Stimmungsstabilisierer kommen auch außerhalb klassischer Bipolar-Diagnosen zum Einsatz. Die genetischen Befunde liefern dafür eine schlüssige Erklärung. Wenn Erkrankungen dieselben biologischen Grundlagen teilen, reagieren sie auch auf ähnliche Behandlungsansätze.
Kenneth Kendler, Professor für Psychiatrie und einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet der psychiatrischen Genetik, beschreibt das Grundproblem so: „Die Psychiatrie ist das einzige medizinische Fach ohne eindeutige Labortests. Wir können keinen Bluttest machen, um festzustellen, ob jemand an einer Depression leidet.“ Behandelt wird deshalb, was sichtbar ist – Symptome und Verhaltensmuster. Die biologischen Ursachen bleiben oft gleich, auch wenn sich die Diagnose im Laufe der Jahre verändert.
Was das für Betroffene bedeutet
Für Menschen mit mehreren Diagnosen kann diese Sichtweise entlastend sein. Sie macht deutlich, dass zusätzliche Diagnosen kein persönliches Scheitern sind. Sie folgen häufig einer biologischen Logik. Gleichzeitig erklärt sie, warum Therapien Zeit brauchen und warum Rückfälle oder neue Symptome auftreten können, selbst wenn frühere Behandlungen geholfen haben.
Besonders auffällig ist der Zusammenhang zwischen den genetischen Risikofaktoren und Merkmalen wie Stressanfälligkeit, Einsamkeit oder emotionaler Verletzlichkeit. Diese Faktoren ziehen sich quer durch viele psychische Erkrankungen. Sie verbinden verschiedene Diagnosen miteinander und prägen den Krankheitsverlauf oft stärker als die formale Bezeichnung.
Kurz zusammengefasst:
- Mehrere psychische Diagnosen sind häufig kein Zufall, sondern entstehen oft aus gemeinsamen genetischen Grundlagen, die viele Erkrankungen biologisch miteinander verbinden.
- Eine große Auswertung zeigt, dass besonders Depressionen, Angststörungen und PTBS fast dieselben genetischen Risikofaktoren teilen und auch Schizophrenie und bipolare Störung enger verwandt sind als lange angenommen.
- Weil Diagnosen auf Symptomen beruhen und nicht auf Labortests, wechseln sie im Lebensverlauf häufiger, obwohl die biologischen Ursachen oft ähnlich bleiben.
Übrigens: Gene erklären nicht nur, warum psychische Diagnosen sich überlagern, sondern führen bei Kindern mit neurologischen Auffälligkeiten oft früh zu klaren Antworten. Wie Gentests Therapien beschleunigen und Familien entlasten, mehr dazu in unserem Artikel.
Bild: © Pexels





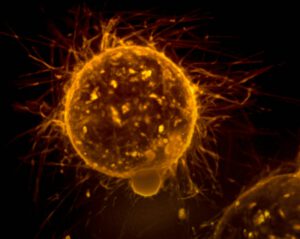
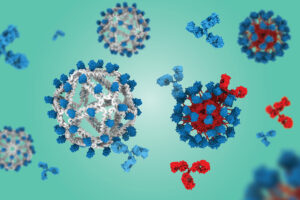






1 Gedanken zu „Warum so viele psychisch Kranke irgendwann noch weitere Diagnosen bekommen“