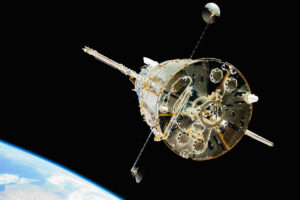Falscher Artenschutz: Je mehr Pandas, desto besser? – Keine gute Idee
Eine neue Studie zeigt: Zu viel Fürsorge kann der Natur schaden. Wenn Symboltiere überhandnehmen, gerät das ökologische Gleichgewicht ins Wanken.

Der Panda gilt weltweit als Symbol für Artenschutz – doch Experten warnen, dass solche Programme oft zu eng greifen und ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen können. © Unsplash
Viele spenden, züchten oder pflanzen Bäume, um bedrohte Tiere zu retten. Doch neue Forschung zeigt: Wer Artenschutz betreibt, kann Arten unbeabsichtigt gefährden – wenn Ökosysteme dabei aus der Balance geraten.
Ein Forschungsteam der Hainan Normal University kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Der Fokus auf einzelne Symboltiere greift zu kurz. Programme, die nur eine Art im Blick haben, können das ökologische Gleichgewicht stören – und so das Gegenteil dessen bewirken, was sie beabsichtigen.
Falsche Ziele im Artenschutz
In ihrer Studie warnen Haitao Shi, Yang Liu und Tien Ming Lee, dass Artenschutz zu oft an der Zahl geretteter Tiere gemessen wird, nicht an der Stabilität ganzer Lebensräume. Diese einseitige Sicht führe dazu, dass Geld, Aufmerksamkeit und politische Energie in Projekte fließen, die zwar viele Tiere hervorbringen, aber wenig Nachhaltigkeit erzeugen.
„Viele Praktiker setzen die Zahl einer charismatischen Art mit der Qualität eines Ökosystems gleich“, schreiben die Autoren. „Doch ein gesundes Gleichgewicht entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch funktionierende Wechselwirkungen zwischen Arten, Lebensräumen und Umwelt.“
Wenn gute Absichten neue Probleme schaffen
Die Studie zeigt, wie schnell gut gemeinte Projekte ins Gegenteil umschlagen können. Beim chinesischen Riesensalamander, einem der größten Amphibien der Welt, wurden in Zuchtstationen Tiere aus unterschiedlichen Regionen miteinander gekreuzt, um den Bestand zu erhöhen.
Später stellte sich heraus: Es handelt sich nicht um eine einzige, sondern um mindestens sieben genetisch verschiedene Arten. Durch die Vermischung ging wertvolle genetische Vielfalt verloren – der Versuch, die Art zu retten, schwächte ihre natürlichen Bestände.
Auch beim Japanischen Ibis hatte der Erfolg seinen Preis. Die Art galt in den 1980er-Jahren fast als ausgestorben. Intensive Zuchtprogramme ließen ihre Zahl auf mehr als 11.000 Tiere anwachsen. Doch in dicht besiedelten Gebieten kam es zu Inzucht, Krankheiten und Nahrungsmangel. Um die Felder pestizidfrei zu halten, wurde vielerorts auf Öko-Reisanbau umgestellt – das half den Vögeln, belastete aber Bauern wirtschaftlich.

Beim Père-David-Hirsch, einst in China ausgerottet, kehrte die Art in großem Stil zurück. Über 12.000 Tiere leben heute in 89 Reservaten. Doch in vielen Gebieten wachsen die Bestände schneller, als die Landschaft sie tragen kann. Manche Schutzgebiete müssen künstliche Mikrohabitate schaffen, um Überpopulationen zu verhindern – ein ökologischer Widerspruch.
Zählen ist nicht Schützen
Diese Fälle stehen für ein größeres Prinzip: Artenschutz darf nicht auf Tierzahlen reduziert werden. Wenn sich Ökosysteme verändern, kippt das Gleichgewicht zwischen Nahrung, Lebensraum und genetischer Vielfalt. Eine wachsende Population ist dann kein Zeichen von Stärke, sondern von Ungleichgewicht.
Die Autoren fordern deshalb ein Umdenken. Statt Mittel in die Aufzucht einzelner Arten zu lenken, sollten Ressourcen dort eingesetzt werden, wo ganze Lebensräume gestärkt werden – also dort, wo Wasserqualität, Böden und ökologische Netzwerke intakt gehalten werden. Nur wenn Ökosysteme als Ganzes funktionieren, können Arten langfristig überleben.
Vier Prinzipien für nachhaltigen Artenschutz
Shi und sein Team nennen vier Grundsätze, die langfristig entscheidend sind:
- Gesunde Ökosysteme statt isolierter Populationen
- Genetische Vielfalt statt einseitiger Zucht
- Natürliche Anpassung statt künstlicher Kontrolle
- Langfristige Stabilität statt kurzfristiger Erfolge
Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann Artenschutz dauerhaft wirken – und die Natur ihr Gleichgewicht selbst finden.
Kurz zusammengefasst:
- Artenschutz funktioniert nur, wenn ganze Ökosysteme stabil bleiben – Zuchtprogramme für einzelne Tierarten können sonst Inzucht, Überbevölkerung und ökologische Schäden verursachen.
- Die Forscher der Hainan Normal University zeigen am Beispiel von Riesensalamander, Japanischem Ibis und Père-David-Hirsch, dass künstlich vermehrte Populationen oft das natürliche Gleichgewicht stören.
- Nachhaltiger Schutz gelingt nur, wenn Lebensräume vernetzt, genetische Vielfalt erhalten und natürliche Prozesse gestärkt werden – nicht, wenn allein die Zahl einer Art als Erfolg gilt.
Übrigens: Auch im Wald kann gut gemeinte Vielfalt schaden. Eine Studie der Universität Freiburg zeigt, dass Artenvielfalt Ökosysteme bei Dürre sogar schwächen kann. Mehr dazu in unserem Artikel.
Bild: © Unsplash