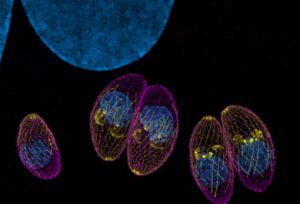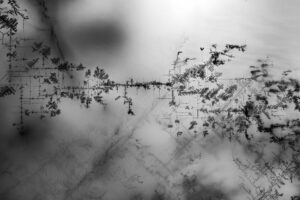Was 2003 im Nordatlantik geschah, wirkt bis heute auf das Leben im Meer
Eine Hitzewelle im Nordatlantik veränderte 2003 Strömungen, Arten und Fischbestände dauerhaft. Die Folgen für Meeresökosysteme und Fischerei wirken bis heute.

Eine marine Hitzewelle im Jahr 2003 veränderte den Nordatlantik so stark, dass sich Artenzusammensetzung und Nahrungsnetze bis heute messbar verschoben haben. © Unsplash
Ein einziges Jahr hat den Nordatlantik spürbar verändert. Die ungewöhnlich starke Hitzewelle im Sommer 2003 traf nicht nur Europa an Land. Auch im Meer entstand eine Situation, die Experten später als „perfekten Sturm“ beschrieben. Warme subtropische Wassermassen strömten weit nach Norden, kaltes arktisches Wasser blieb aus, die Atmosphäre erreichte Rekordtemperaturen – und genau diese Kombination brachte das Ökosystem aus dem Gleichgewicht.
Die Folgen reichten tief in die Nahrungsketten hinein. Arten verschoben ihre Verbreitung, Laichgebiete änderten sich, manche Bestände brachen ein, andere gewannen Raum. Für Fischerei und Meeresforschung gilt 2003 deshalb heute als Wendepunkt: ein Jahr, das noch Jahrzehnte später messbare Spuren hinterlässt.
Hitzewelle verändert den Nordatlantik bis in die Tiefe
Durch die außergewöhnliche Hitzewelle im Nordatlantik erwärmte sich das Meer innerhalb kurzer Zeit stark. Messungen zeigen Rekordwerte, nicht nur an der Oberfläche, sondern bis in Tiefen von rund 700 Metern, besonders in der Norwegischen See. Gleichzeitig verschoben sich großräumige Strömungen. Warmes Wasser aus dem subtropischen Nordatlantik drang weit nach Norden vor. Kaltes, nährstoffreiches Wasser aus der Arktis blieb ungewöhnlich häufig aus.
Die wissenschaftliche Auswertung stammt von einem Forschungsteam unter Leitung des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei. Grundlage sind umfangreiche Langzeitdaten aus fast hundert Zeitreihen – insgesamt 88 Messreihen mit Laufzeiten von bis zu 75 Jahren, darunter Tiefenmessungen in rund 100 Metern Wassertiefe sowie satellitengestützte Oberflächendaten, die bis in die 1940er-Jahre zurückreichen.
Ein Teil davon stammt aus dem Langzeitobservatorium HAUSGARTEN des Alfred-Wegener-Instituts in der Framstraße, einer zentralen Meerespassage zwischen Grönland und Spitzbergen, wo seit rund 25 Jahren kontinuierlich gemessen wird.
Der „perfekte Sturm“ im Nordatlantik
Die Forscher analysierten 88 Temperatur-Zeitreihen, viele mit Messungen über mehr als sechs Jahrzehnte. Der Vergleich fällt eindeutig aus. Kein anderes Jahr zeigt so viele marine Hitzeextreme wie 2003. Entscheidend war nicht allein die Wärme. Erst das Zusammenspiel mehrerer Faktoren machte die Lage außergewöhnlich.
Ein geschwächter subpolarer Wirbel – ein großräumiges Zirkulationssystem im Nordatlantik, das normalerweise kaltes, nährstoffreiches Wasser nach Süden verteilt – ließ große Mengen subtropischen Wassers weit nach Norden fließen. Gleichzeitig strömte deutlich weniger kaltes Wasser aus der Arktis nach Süden. Hinzu kamen ungewöhnlich hohe Lufttemperaturen über dem Atlantik. Das Meer konnte die Wärme kaum abgeben. In der Forschung ist von einem „perfekten Sturm“ die Rede, einer seltenen Kombination, die das Ökosystem unvorbereitet traf.
Der Umbruch beginnt ganz unten im Meer
Die ersten Veränderungen zeigten sich ganz unten im Nahrungsnetz. Zooplankton, also winzige Krebstiere, nahm in Teilen des Nordatlantiks deutlich ab. Besonders betroffen waren arktische Arten. Wärmeliebende Verwandte aus südlicheren Regionen setzten sich durch. Die Folgen waren klar messbar:
- weniger Nahrung für Jungfische
- schlechtere Wachstumsbedingungen
- sinkende Überlebenschancen für Fischlarven
Hering, Makrele und Lachs reagierten spürbar. Wanderungen verschoben sich. Laichgebiete verloren an Qualität. Einige Bestände brauchten Jahre, um sich neu einzupendeln.
Ein Futterfisch verschwindet, Wale ziehen nach
Besonders einschneidend war die Entwicklung bei der Lodde. Der kleine Schwarmfisch ist eine Schlüsselart im Nordatlantik. Er ernährt Kabeljau, Robben und Wale. Nach 2003 verlagerte sich sein klassisches Laichgebiet deutlich nach Norden. Eier und Larven gerieten in neue Strömungsmuster und trieben bis an die Küste Ostgrönlands. Dort trafen sie auf Bedingungen, an die ihr Lebenszyklus nicht angepasst ist. Die Fangmengen brachen ein.

Andere Arten profitierten. Wale folgten ihrer Beute. Buckelwale tauchten nach mehr als 150 Jahren wieder regelmäßig vor Südostgrönland auf. Auch Orcas wurden dort häufiger gesichtet. Kälteabhängige Meeressäuger wie Narwale verloren dagegen Lebensraum.
Verzögerte Effekte in der Tiefsee
Nicht alle Veränderungen traten sofort auf. In der Framstraße erreichte das warme Wasser den Meeresboden erst mit Verzögerung, teils Jahre nach der eigentlichen Hitzewelle. Dort änderte sich die Zusammensetzung von Algen und absinkender Biomasse. Zwar gelangte mehr organisches Material in die Tiefe, doch dessen Nährwert nahm ab.
Kleinere Bodenorganismen reagierten schnell. Größere Arten folgten später. Die Wissenschaftler beobachteten Verschiebungen selbst in mehreren Tausend Metern Tiefe. Solche Prozesse laufen langsam, prägen das Ökosystem aber über lange Zeiträume.
Ökologie verändert Fanggebiete und Erträge
Die ökologischen Verschiebungen blieben nicht ohne wirtschaftliche Konsequenzen. Fischereien passten ihre Strategien an. Fanggebiete verlagerten sich. In einigen Regionen profitierten einzelne Arten stark. Beim Schellfisch etwa erreichte der Nachwuchs im Jahr 2003 ungewöhnlich hohe Werte. Später stiegen die Fangmengen deutlich.
Beim Kabeljau in grönländischen Gewässern führte der Temperaturanstieg sogar zur Wiederaufnahme einer lange ruhenden Fischerei. Gleichzeitig verschwanden bodennahe Arten aus traditionellen Fanggründen. Die Zusammensetzung ganzer Fischgemeinschaften änderte sich dauerhaft. „Die Auswirkungen eines solchen Ereignisses reichen bis an uns Menschen heran, weil sie die Verbreitung von Fischarten verändern, die wir essen und an die der Fischfang seit Jahrzehnten angepasst ist“, erklärt Erstautor Karl-Michael Werner, Meeresökologe am Thünen-Institut und Mitautor mehrerer internationaler Langzeitstudien zum Nordatlantik.
Hitze allein erklärt die Umbrüche nicht
Nach 2003 folgten weitere warme Jahre. Marine Hitzephasen blieben häufig. Dennoch kam es nicht erneut zu vergleichbaren Umbrüchen. Die Studie liefert dafür eine klare Erklärung. Wärme allein reicht nicht aus. Erst wenn Strömungen, Lufttemperaturen und Ozeandynamik zusammenkommen, entstehen solche Kettenreaktionen.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass unerwartete Extremereignisse nicht vorhersehbare ökologische Kaskaden auslösen“, sagt Werner. Welche Folgen künftige Erwärmung haben wird, bleibt offen. Sicher ist nur, dass einzelne Extremjahre das Leben im Meer über Jahrzehnte prägen können.
Kurz zusammengefasst:
- Eine extreme Hitzewelle im Jahr 2003 veränderte den Nordatlantik dauerhaft, weil ungewöhnlich hohe Temperaturen mit veränderten Meeresströmungen zusammentrafen und das ökologische Gleichgewicht abrupt kippten.
- Die Folgen zogen sich durch alle Ebenen des Meeres, vom Plankton über Fischbestände bis zu Walen: Nahrungsketten verschoben sich, einige Arten verloren Lebensraum, andere breiteten sich aus.
- Fischerei und Ökosysteme reagieren bis heute auf dieses Ereignis, weil ein einzelner Klimaschock langfristige Veränderungen auslösen kann, die sich nicht automatisch wieder zurückbilden.
Übrigens: Im Nordatlantik gibt es so große Mengen Nanoplastik, dass selbst erfahrene Experten schockiert sind – und die winzigen Partikel erreichen längst Regionen, die als unberührbar galten. Mehr dazu in unserem Artikel.
Bild: © Unsplash