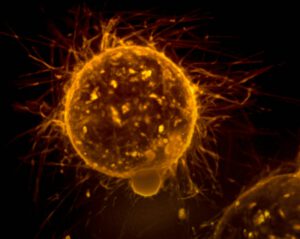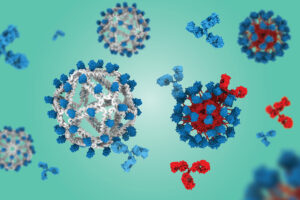Bildschirmzeit bei Kleinkindern verändert das Gehirn – doch eine Sache schützt überraschend
Frühe Bildschirmzeit verändert die Hirnentwicklung von Kleinkindern – regelmäßiges Vorlesen kann einen großen Teil der Effekte abmildern.

Eine Langzeitstudie aus Singapur zeigt: Bildschirmzeit bei Kleinkindern verändert die Hirnentwicklung und steht später mit Angstsymptomen in Verbindung. © Freepik
Bildschirmzeit bei Kleinkindern ist heute keine Ausnahme mehr, sondern Teil des Alltags vieler Familien. Eltern nutzen digitale Inhalte, um kurze Pausen zu schaffen oder Abläufe zu erleichtern. Langzeitdaten legen jedoch nahe: Eindrücke aus den ersten Lebensjahren wirken stärker nach als vieles, was später folgt.
Die ersten beiden Lebensjahre gelten als besonders empfindliche Phase. In dieser Zeit wächst das Gehirn rasant. Nervenverbindungen entstehen, andere werden sortiert, grundlegende Netzwerke bilden sich. Umweltreize haben dabei großes Gewicht. Eine neue Studie macht deutlich, dass frühe Medienreize diese Prozesse messbar beeinflussen können. Die Folgen treten oft erst Jahre später zutage.
Bildschirmzeit bei Kleinkindern beschleunigt die Gehirnreifung
Die Forscher begleiteten Kinder aus einer großen Geburtskohorte über mehr als zehn Jahre. Sie erfassten unter anderem, wie viel Zeit Kinder im Alter von ein und zwei Jahren mit Bildschirmen verbrachten. Später folgten mehrere Hirnscans sowie Tests zu Denken, Entscheiden und emotionalem Befinden.
Im Zentrum standen bestimmte Hirnnetzwerke, die Sehen, Aufmerksamkeit und gedankliche Kontrolle verbinden. Normalerweise entwickeln sich diese Strukturen Schritt für Schritt. Bei Kindern mit höherer früher Mediennutzung verschob sich dieses Gleichgewicht schneller. Die Netzwerke spezialisierten sich früher als üblich. Die Wissenschaftler sprechen von einer beschleunigten Reifung. „Beschleunigte Reifung bedeutet, dass sich bestimmte Netzwerke zu früh festlegen“, erklärt Dr. Huang Pei, Erstautor der Studie. Das könne die spätere Anpassungsfähigkeit einschränken.
Spätere Effekte zeigen sich beim Entscheiden
Die Veränderungen blieben nicht auf Hirnscans beschränkt. Mit etwa achteinhalb Jahren nahmen die Kinder an einem standardisierten Entscheidungstest teil. Bewertet wurde nicht richtig oder falsch, sondern die Zeit bis zur Entscheidung.
Dabei fiel auf: Kinder mit veränderter Netzwerkentwicklung benötigten länger, um sich festzulegen. Die Qualität der Entscheidungen blieb stabil, doch der Weg dorthin dauerte länger. Die Forscher werten dies als Hinweis auf eine geringere Effizienz im Zusammenspiel von Wahrnehmung und Kontrolle.
Verzögerte Entscheidungen erhöhen das Angstrisiko
Im Jugendalter, mit rund 13 Jahren, beantworteten dieselben Kinder Fragebögen zu Angstsymptomen. Hier zeigte sich ein weiterer Zusammenhang. Längere Entscheidungszeiten im Kindesalter gingen mit höheren Angstwerten einher.
Entscheidend war die Abfolge. Einen direkten Zusammenhang zwischen früher Mediennutzung und späterer Angst fanden die Forscher nicht. Erst die Reihenfolge machte den Unterschied: frühe Reize, veränderte Hirnentwicklung, verlangsamtes Entscheiden, mehr Angstsymptome. Diese Abfolge ließ sich statistisch absichern.
Vorlesen wirkt als natürlicher Ausgleich
Die Studie enthält auch eine positive Nachricht. Zusätzlich untersuchten die Experten, wie häufig Eltern ihren Kindern im Alter von drei Jahren vorlasen. Das Ergebnis: Gemeinsames Lesen schwächte den Zusammenhang zwischen früher Mediennutzung und Hirnveränderungen deutlich ab.
Bei Kindern, denen regelmäßig vorgelesen wurde, verlor die frühe Medienzeit ihren messbaren Einfluss auf die Hirnnetzwerke. Offenbar wirkt die gemeinsame Aktivität als Ausgleich. Sprache, Blickkontakt und gegenseitige Reaktionen fordern das Gehirn anders als passive Inhalte.
Studienleiterin Tan Ai Peng erklärt: „Diese Ergebnisse liefern eine biologische Erklärung, warum es wichtig ist, Medienzeit in den ersten zwei Jahren zu begrenzen.“ Zugleich zeige sich, „dass gemeinsames Lesen einen echten Unterschied machen kann“.
Frühe Lebensphase verlangt bewusste Routinen
Die Daten lenken den Blick auf ein sehr frühes Zeitfenster. Mediennutzung mit drei oder vier Jahren zeigte in der Studie keine vergleichbaren Effekte. Ausschlaggebend blieben die ersten beiden Lebensjahre. Gleichzeitig liefern die Ergebnisse konkrete Hinweise für den Alltag. Hilfreich sind vor allem Aktivitäten, die Austausch fördern:
- Vorlesen mit Blickkontakt und Gespräch
- Gemeinsames Betrachten von Bildern
- Spielen ohne feste Vorgaben
Solche Routinen stärken Netzwerke, die später für Denken und emotionale Stabilität wichtig sind.
Den Studienautoren zufolge geht es um Wahrscheinlichkeiten: Medienzeit wirkt nicht isoliert. Schlaf, Bewegung, Interaktion und familiäre Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine Rolle. Dennoch zeigen die Daten, dass frühe Medienreize ein sensibler Faktor bleiben.
Kurz zusammengefasst:
- Bei Kleinkindern ist frühe Bildschirmzeit besonders wirksam, weil sie in den ersten zwei Lebensjahren die Reifung wichtiger Hirnnetzwerke beeinflussen kann.
- Die Effekte zeigen sich zeitverzögert, da veränderte Hirnentwicklung später mit langsameren Entscheidungen und höheren Angstsymptomen zusammenhängt.
- Gemeinsames Vorlesen kann gegensteuern, weil aktive Eltern-Kind-Interaktion die negativen Effekte früher Medienreize messbar abschwächt.
Übrigens: Nicht nur bei Kleinkindern hinterlässt frühe Mediennutzung Spuren – auch bei Jugendlichen zeigt sich, wie stark Bildschirmzeit Körper und Stimmung aus dem Gleichgewicht bringen kann. Warum vor allem Mädchen mit schlechterem Schlaf und depressiven Symptomen reagieren, mehr dazu in unserem Artikel.
Bild: © Freepik