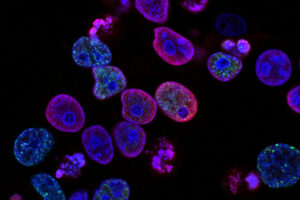Kleine Geräte, große Nebenwirkung: Wenn tragbare Medizintechnik zum Klimafaktor wird
Medizinische Wearables gelten als Fortschritt. Doch ihre Elektronik und kurze Lebensdauer machen sie zu einem wachsenden Klimafaktor.

Forscher rechnen bis 2050 mit bis zu zwei Milliarden medizinischen Geräten pro Jahr – und stark wachsendem Elektroschrott sowie CO₂-Ausstoß. © Unsplash
Ein dünnes Pflaster auf der Haut misst den Blutzucker. Ein kleiner Sensor am Handgelenk überwacht den Blutdruck, rund um die Uhr. Tragbare Medizintechnik wirkt sauber, leise und unauffällig. Sie verspricht Sicherheit im Alltag und Entlastung für Ärzte. Kaum jemand verbindet diese Geräte mit Bergbau, Energieverbrauch oder Müll. Doch genau dort beginnt ihre zweite Seite.
Schon heute hinterlässt jedes einzelne Wearable einen messbaren CO₂-Fußabdruck. Je nach Gerät entstehen zwischen 1,1 und 6,1 Kilogramm CO₂-Äquivalente – gerechnet vom Rohstoffabbau bis zur Entsorgung. Das entspricht einer Autofahrt von 25 bis 30 Kilometern. Hochgerechnet auf Millionen Geräte entsteht damit ein relevantes Klimaproblem.
Der CO₂-Fußabdruck von Wearables wächst schneller als gedacht
Bis 2050 könnte sich der weltweite Einsatz medizinischer Wearables um den Faktor 42 erhöhen. Dann würden fast zwei Milliarden Geräte pro Jahr produziert. Diese Größenordnung beschreibt eine Analyse, die im Fachjournal Nature erschien und von Forschern der University of Chicago und der Cornell University erarbeitet wurde.
Allein für das Jahr 2050 rechnen die Autoren mit rund 3,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten. Hinzu kommen Elektroschrott und Umweltgifte aus der Produktion. Kleine Medizingeräte erreichen damit eine Dimension, die sonst nur großen Industriezweigen zugeschrieben wird.
Nicht das Gehäuse, sondern die Elektronik treibt die Emissionen hoch
Überraschenderweise fällt der größte Teil der Emissionen nicht beim Gehäuse an. Der Großteil der Klimabelastung geht auf das Konto der Elektronik – vor allem der Leiterplatten und integrierten Schaltkreise. Sie steuern die Geräte, erfordern eine energieintensive Fertigung und beruhen auf rohstoffaufwendigem Bergbau.
„Mehr als 70 Prozent des CO₂-Fußabdrucks eines Geräts stammen von den Leiterplatten“, erklärt Studienautor Bozhi Tian, Chemieprofessor in Chicago. Selbst ein kompletter Austausch aller Kunststoffe durch biologisch abbaubare Materialien würde die Emissionen lediglich um rund drei Prozent senken.
Warum seltene Metalle das Klima besonders belasten
Ein zentraler Grund liegt im Materialmix moderner Chips. Leiterbahnen bestehen häufig aus Gold und anderen kritischen Metallen. Pro Gerät sind es nur kleine Mengen. Doch ihr Abbau verursacht hohe Emissionen und große Abraumhalden. Auch die Weiterverarbeitung verbraucht viel Energie.
„Wenn diese Geräte weltweit eingesetzt werden, summieren sich kleine Designentscheidungen sehr schnell“, so Mitautor Chuanwang Yang. Der ökologische Preis entsteht nicht beim Tragen der Sensoren, sondern tief in Lieferketten und Fabriken.
Einwegtechnik aus medizinischen Gründen
Viele Wearables sind bewusst auf kurze Einsatzzeiten ausgelegt. Medizinische Vorgaben setzen enge Grenzen. Hautkontakt über Wochen erhöht das Risiko von Entzündungen. Sensoren verlieren mit der Zeit an Genauigkeit. Auch kleinste Abweichungen können Diagnosen verfälschen. Deshalb werden viele Geräte vorsorglich ersetzt, lange bevor sie technisch verbraucht sind.
So landen Sensoren oft schon nach wenigen Wochen im Müll. Im Vergleich zu Smartphones oder Kopfhörern verlassen medizinische Geräte den Nutzungskreislauf deutlich schneller. Der CO₂-Fußabdruck von Wearables entsteht damit weniger durch falsches Nutzerverhalten, sondern vor allem durch Designentscheidungen, Zulassungsregeln und industrielle Standards.
Modulare Bauweise bietet den größten Hebel
Die Analyse benennt mehrere Ansätze zur Entlastung. Der wirksamste betrifft den Aufbau der Geräte. Wenn Hüllen regelmäßig ersetzt würden, die integrierten Schaltkreise aber erhalten blieben, ließe sich der größte Emissionsposten vermeiden. Eine modulare Bauweise könnte den Bedarf an neuen Chips deutlich senken.
Ein weiterer Hebel liegt in der Metallwahl. Kupfer oder Aluminium sind leichter verfügbar als Gold. Zwar reagieren diese Metalle stärker. Doch laut Berechnungen ließen sich Leistungseinbußen durch geeignete Schutzschichten vermeiden. „Viele gingen davon aus, dass man Leistung opfern muss. Unsere Auswertung deutet darauf hin, dass dies nicht nötig ist“, sagt Tian.
Auch der Strommix beeinflusst die Klimabilanz
Neben Material und Design spielt die Energieversorgung eine Rolle. Würden Wearables ausschließlich mit erneuerbarem Strom gefertigt, sänke der CO₂-Ausstoß um etwa 15 Prozent. Allein reicht dieser Schritt nicht aus. In Kombination mit besserer Elektronikarchitektur gewinnt er jedoch Gewicht.
„Nachhaltigkeit in dieser Größenordnung lässt sich nur erreichen, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet“, erklärt Yang. Für die digitale Medizin entscheidet sich damit ein Teil ihres Fortschritts im Inneren der Technik – dort, wo Gesundheit und Klimaschutz unerwartet aufeinandertreffen.
Kurz zusammengefasst:
- Medizinische Wearables verursachen bereits heute einen relevanten CO₂-Fußabdruck: Pro Gerät fallen über den gesamten Lebenszyklus 1,1 bis 6,1 Kilogramm CO₂ an, vor allem durch Elektronik und kurze Nutzungszeiten.
- Bis 2050 wächst das Problem stark: Die weltweite Nutzung könnte sich um den Faktor 42 erhöhen, auf fast zwei Milliarden Geräte pro Jahr, mit rund 3,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten jährlich.
- Der größte Hebel liegt im Design: Rund 70 Prozent der Emissionen gehen auf Leiterplatten und Chips zurück; modulare Bauweisen, andere Metalle und erneuerbare Energie können die Klimabilanz deutlich verbessern.
Übrigens: Forscher senden Informationen inzwischen direkt per Licht ins Gehirn – ganz ohne Augen, Ohren oder Haut, und das Gehirn lernt diese künstlichen Signale wie eine neue Wahrnehmung. Wie ein drahtloses Implantat Nervenzellen gezielt aktiviert und Verhalten steuert, mehr dazu in unserem Artikel.
Bild: © Unsplash