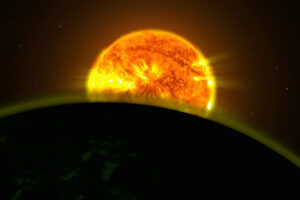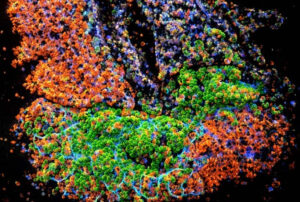Alte Umweltsünde: Blei aus Benzin belastet den Arktischen Ozean
Eine neue Studie belegt, dass Blei aus dem Nordatlantik bis in die Arktis gelangt und sich dort im Meeresboden anreichert.

Der Forschungseisbrecher „Polarstern“ des Alfred-Wegener-Instituts ermöglichte die Probenahme im Eis und lieferte zentrale Daten zum Bleieintrag aus dem Nordatlantik in den Arktischen Ozean. © Stephan Krisch/TU Braunschweig
Verbleites Benzin gehört zu den dunklen Umweltkapiteln des vergangenen Jahrhunderts. Es ist längst verboten, aus dem Alltag verschwunden, scheinbar erledigt. Doch Spuren dieser Zeit sind noch immer zu finden – weit entfernt von Straßen, Motoren und Städten. Eine neue Studie zeigt, dass dieses Blei im Arktischen Ozean nachwirkt. Und sie macht deutlich, warum der Klimawandel alte Schadstoffe wieder in Bewegung bringen kann.
Blei kann das Nervensystem schädigen, sich im Körper anreichern und gilt als krebserregend. Lange galt der hohe Norden als abgeschirmt von großen Emissionsquellen. Aktuelle Messungen zeichnen jedoch ein anderes Bild: Der Arktische Ozean hat über Jahrzehnte beträchtliche Mengen Blei aufgenommen, die mit Strömungen aus dem Nordatlantik herangetragen wurden.
Der Arktische Ozean als Senke für Blei aus dem Atlantik
Die Ergebnisse stammen aus einer internationalen Untersuchung mit Beteiligung der Technischen Universität Braunschweig. Forscher analysierten Wasserproben und Sedimente aus zentralen Meerengen zwischen Atlantik und Arktis. Dazu gehörten die Framstraße, die Barentssee und Gewässer der kanadischen Arktis. Erstmals ließ sich so belastbar berechnen, wie viel menschengemachtes Blei in die nördlichen Gefielde gelangt.
Der Arktische Ozean wirkt dabei wie ein Auffangbecken. Jährlich strömen mehrere Hundert Tonnen gelöstes Blei aus dem Nordatlantik in arktische Gewässer. Ein Teil fließt zurück, doch unterm Strich bleibt ein deutlicher Überschuss. Gespeichert wird das Gift vor allem im Meeresboden.

Altes Benzin als Hauptquelle der Belastung
Der Ursprung liegt Jahrzehnte zurück. Im 20. Jahrhundert setzte die weltweite Nutzung von verbleitem Benzin enorme Bleimengen frei. Abgase transportierten das Metall in die Atmosphäre. Winde verteilten es über Kontinente und Ozeane. Besonders stark betroffen war der Nordatlantik, nahe großer Emissionsgebiete in Europa und Nordamerika.
Obwohl verbleites Benzin seit den 1980er- und 1990er-Jahren schrittweise verboten wurde, bleibt die Belastung messbar. Noch Jahrzehnte später gelangt ähnlich viel Blei in die Arktis wie über natürliche Flüsse. „Wir waren überrascht von der Menge an Blei, die aus dem Atlantik in den Arktischen Ozean gelangt“, sagt Studienleiter Stephan Krisch.
Was Messfahrten im Eis sichtbar machten
Zwischen 2015 und 2016 untersuchten mehrere Expeditionen die Wasserströme zwischen Atlantik und Arktis. Moderne Messverfahren machten selbst extrem geringe Bleikonzentrationen sichtbar. Diese Technik steht erst seit wenigen Jahrzehnten zur Verfügung. Frühere Generationen hätten diese Spuren kaum erfassen können.
Besonders aufschlussreich war der Blick auf die Meeresströmungen. Atlantisches Wasser fließt kontinuierlich in die Arktis. Dabei transportiert es gelöstes Blei. Ein Teil sinkt gemeinsam mit Partikeln in größere Tiefen. Dort lagert sich das Metall im Sediment ab. So entsteht über Jahre hinweg eine wachsende Belastung.
Sedimente erreichen kritische Schwellen
In arktischen Tiefseesedimenten messen die Wissenschaftler stellenweise mehr als 30 Milligramm Blei pro Kilogramm. In weniger belasteten Regionen liegen die Werte deutlich darunter. Ab etwa 36 Milligramm gelten Schäden für bodenlebende Organismen als möglich.
Die Studie schätzt, dass sich seit 1970 insgesamt rund 75.000 Tonnen menschengemachtes Blei aus dem Atlantik in der Arktis angesammelt haben könnten. In früheren Jahrzehnten lag der jährliche Eintrag sogar um ein Mehrfaches höher als heute.
Isotope verraten die Herkunft
Um die Quellen eindeutig zu klären, nutzten die Forscher Isotopenmessungen. Jede Bleiquelle besitzt eine charakteristische Zusammensetzung. Diese chemischen Fingerabdrücke erlauben eine klare Zuordnung.

Die Analysen zeigen vor allem Signaturen aus Nordamerika und Europa. Mitautorin Arianna Olivelli erklärt: „Hochpräzise Messungen der Blei-Isotopenzusammensetzung ermöglichen es uns, zwischen natürlichen und anthropogenen Quellen zu unterscheiden.“ Die Werte passen zu Erzen, die früher für Benzinadditive genutzt wurden.
Klimawandel verstärkt alte Altlasten
Der Blick nach vorn macht die Ergebnisse besonders brisant. Der Klimawandel verändert die Arktis schneller als viele andere Regionen. Meereis verschwindet, Küsten erodieren stärker, Sedimente werden häufiger aufgewirbelt.
Dabei kann gebundenes Blei wieder ins Wasser gelangen. Professor Harald Biester warnt: „Der rasante Verlust von Meereis und die Zunahme von Sedimenterosion können die erneute Freisetzung von Blei begünstigen.“ Welche Folgen das für Algen, Fische und Nahrungsketten hat, ist bislang offen.
Kurz zusammengefasst:
- Blei aus dem Zeitalter des verbleiten Benzins gelangt bis heute in den Arktischen Ozean und sammelt sich dort vor allem im Meeresboden an.
- Messungen zeigen, dass der Arktische Ozean große Mengen Blei speichert und Sedimente stellenweise Konzentrationen erreichen, die für Meeresorganismen problematisch sein können.
- Der Klimawandel kann diese Altlast verschärfen, weil schwindendes Meereis und stärkere Erosion gebundenes Blei erneut ins Meerwasser freisetzen können.
Übrigens: Erdbeben am Meeresboden können Algenblüten im Südpolarmeer verstärken, weil sie nährstoffreiches Wasser freisetzen. Wie eng Geologie, Leben und Klima dabei verknüpft sind – mehr dazu in unserem Artikel.
Bild: © Stephan Krisch/TU Braunschweig